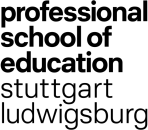Aktuelle Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2025
Im Wintersemester 2025/2026 biete ich folgende Veranstaltungen an:
1. Diesseits und jenseits von Binarität - Geschlecht, Behinderung, psychische Krankheit, sexuelle Orientierung als Kategorien der Humandifferenzierung. Donnerstags, 14.15 bis 15.45 Uhr, Raum 8A/002, ab 23.10.2025.
Menschen, die in sozialen Beziehungen stehen, müssen einander in den unterschiedlichsten Hinsichten kategorisieren. Immer. Das ist ein soziologisches Faktum, an dem niemand vorbei kommt. Die offene Frage ist aber, auf welche Weise dies geschieht: wie flexibel sind diese Kategorisierungen, gelten sie schlechthin, situationsübergreifend oder kontextbezogen, nur für bestimmte Aspekte der Individuen oder für die ganze Person, zeitlich befristet oder für immer, sind sie mit Aufwertungen/Abwertungen oder mit Einbeziehungen/Ausgrenzungen verbunden? Eine sowohl für die Sonderpädagogik als auch für die gesellschaftliche und politische Diversitäts-Diskussion ganz zentrale Frage berührt dabei die Frage der Binarität (=Zweistelligkeit, Zweiwertigkeit) solcher Kategorien. Ist man entweder Mann oder Frau? Behindert oder nicht-behindert? Psychisch krank oder psychisch gesund? Hetero- oder homosexuell? Gibt es etwas dazwischen? Kann man ein bisschen, mehr oder weniger Mann, Frau, heterosexuell oder schwul/lesbisch, behindert oder psychisch krank sein? Gibt es etwas drittes (oder viertes, fünftes...)? Das sind zugleich Fragen, die heute Bestandteile von globalen, äußerst emotional geführten, teilweise bereits militarisierten Kulturkämpfen darstellen. Desto wichtiger ist es, hier eine Ebene der Versachlichung anzustreben. Dafür werden wir in diesem Seminar zum einen auf neuere soziologische Theorieansätze, insbesondere die Theorie der Humandifferenzierung im Anschluss an Stefan Hirschauer sowie auf empirische Studien zu den genannten Themen Sex/Gender, Behinderung, psychische Krankheit, sexuelle Orientierung zurückgreifen. Gegenstand des Seminars wird dabei eine genaue Analyse sowie ein Vergleich zwischen diesen Kategorien sein. Es wird sich dabei zeigen, dass sich das Problem von Binarität und Nicht-Binarität jeweils auf ganz verschiedene Weise stellt und seine denkbaren Lösungen ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die professionelle Praxis der Sonderpädagogik haben.
Literatur:
Stefan Hirschauer (2020): Undoing differences revisited. Unterscheidungsnegation und Indifferenz in der
Humandifferenzierung. In Zeitschrift für Soziologie Jg. 49: 318–334
Stefan Hirschauer (2021): Menschen unterscheiden. Grundlinien einer Theorie der Humandifferenzierung. In Zeitschrift für Soziologie Jg. 50: 155–174
Bemerkung:
Das Seminar findet durchweg als Präsenzveranstaltung statt. Voraussetzung für die Verbuchung der zwei Kontakt-CP sind drei Original-Unterschriften (Anfang, Mitte, Schluss), die im Seminar eingeholt werden. Prüfungsformen sind Präsentationen + schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeit im Umfang von 2/3 CP), sowie unbenotete und benotete 1-CP-Leistungen nach Absprache mit jmk.
2. Soziologie der Behinderung. Donnerstags, 16.15 -17.45 Uhr, Raum 8A/002, ab 23.10.2025
IBehinderung ist ein soziales Phänomen, weil unser Körper (einschließlich seiner psychischen und kognitiven Funktionen) immer auch ein soziales Phänomen ist. Das ist der Ausgangspunkt der Soziologie der Behinderung, die in diesem Seminar im Mittelpunkt steht. Davon ausgehend werden - immer an Beispielen entlang - Fragen gestellt wie:
• Wie sehen, erfahren, interpretieren wir Behinderungen?
• Was bedeutet das "soziale Modell" der Behinderung?
• Gibt es eine barrierefreie Gesellschaft?
• Kann und soll man Behinderung definieren?
• Ist Behinderung nur eine soziale Konstruktion?
• Was heißt "Inklusion" und wie kann man Inklusion von verwandten Begriffen wie "Integration" und "Teilhabe" abgrenzen?
Wir werden uns mit dem Verhältnis von Gesundheit und Gesellschaft befassen und die Frage stellen, welche Rolle gesellschaftliche Verhältnisse bei der Beeinträchtigung und Schädigung körperlicher, psychischer oder kognitiver Funktionen spielen können. Es wird um Vorurteile, Ausgrenzung und Stigmatisierung behinderter und psychisch kranker Menschen gehen. An ausgewählten historischen Beispielen wird gezeigt, wie unterschiedliche gesellschaftliche Konstruktionen und Deutungen von Behinderung aussehen können und welche Auswirkungen solche Konstruktionen haben können. In diesem Sinne wird es darauf ankommen mindestens drei Aspekte miteinander zu verknüpfen und in ihrer wechselseitigen Verschränkung zu betrachten:
• soziale Produktion: Sowohl körperliche wie kognitive und psychische Behinderungen bzw. die mit ihnen zusammenhängenden Schädigungen können durch soziale Verhältnisse kausal verursacht werden, z.B. durch Armut, Gewalt, deprivierende Lebensverhältnisse. Besonders interessant sind hier neuere Studien über den Zusammenhang von Armut, Stress und kognitiver Leistungsfähigkeit im Spannungsfeld von Soziologie und Neurowissenschaften.
• soziale Reaktion: das soziale Umfeld reagiert auf Behinderung, egal, welche Ursachen sie hat. Diese Reaktion –positiv, negativ (stigmatisierend), zumeist aber: ambivalent – tritt mit der Behinderung unmittelbar in Interaktion und bestimmt ihre individuelle und soziale Realität mit. In diesem Zusammenhang soll auch ein soziologischer Blick auf die Frage der Inklusion und Integration behinderter Menschen geworfen werden.
• soziale Konstruktion: Behinderungen werden auf verschiedenen Ebenen (Gesellschaft, Familie, persönliche
Beziehungen) sozial ausgedeutet und interpretiert und umgekehrt: die sozialen Deutungsmuster prägen ihre Wirklichkeit und die sozialen Reaktionen wesentlich mit. Insbesondere die sogenannten Disability Studies beschäftigen sich mit diesem Aspekt der kulturellen Relativität von Behinderung. Wir werden uns an zwei kontrastierenden Beispielen mit der sozialen Konstruktion von Behinderung befassen: den sogenannten „Freakshows” und der nationalsozialistischen Propaganda („Rassenhygiene”).
Grundlage des Seminars ist das Lehrbuch "Einführung in die Soziologie der Behinderung" des Dozenten. Über dieses Buch sollte jeder Seminarteilnehmer und jede Seminarteilnehmerin verfügen.
Literatur:
Jörg Michael Kastl: Einführung in die Soziologie der Behinderung. Wiesbaden (VS) 2017 (2. Auflage).
Bemerkung:
Das Seminar findet durchweg als Präsenzveranstaltung statt. Voraussetzung für die Verbuchung der zwei Kontakt-CP sind drei Original-Unterschriften (Anfang, Mitte, Schluss), die im Seminar eingeholt werden. Prüfungsformen sind Präsentationen + schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeit im Umfang von 2/3 CP), sowie unbenotete und benotete 1-CP-Leistungen nach Absprache mit jmk.
3. Pädagogische Professionalität in Schule und Sozialer Arbeit. Freitags, 10.15-11.45 Uhr, Raum 8A/003, ab 24.10.2025.
Was eigentlich "Professionalität" in Bezug auf pädagogisches und sozialpädagogisches Handeln meint, ist durchaus umstritten. Die Diskussion bewegt sich dabei zwischen seltsamen Extremen. Auf der einen Seite findet sich eine omnipräsente Semantik von Qualitätsmanagement, Kundenorientierung und "lernender Organisation", die sich in Schule, Sozialarbeit und Wissenschaft mittlerweile auch im praktischen Alltag ausbreitet. Pädagogisches Handeln, das sich an ausformulierten Leitbildern, möglichst sog. "smarten" Zielen und Qualitätsstandards orientiert, wird heutzutage gerne mit "professionell" gleichgesetzt. Nimmt man das ernst, wird hier aber letztlich pädagogisches Handeln zu einer Form bürokratisch-administrativen bzw. outputorientiertem wirtschaftlichem Handeln umgeformt.
Das andere Extrem könnte man mit dem Etikett einer von Helsper so genannten "Pädagogik der Aufdringlichkeit" bezeichnen. Für dieses Verständnis von Professionalisierung ist die undifferenzierte Betonung der Ganzheitlich-keit des pädagogischen Handelns typisch, der "ganze Mensch", das Individuum und seine "Bedürfnisse" stehen im Mittelpunkt, die "pädagogische Beziehung" sei das A und das O. Hier wird der Charakter der "funktionalen Spezifizität des pädagogischen Handelns geleugnet, ungenügend gesichert oder sogar strukturell überschritten und pädagogisches Handeln tendenziell nach einem Muster von Freundschafts- oder Familienbeziehungen verstanden.
Das in diesem Seminar vorgestellte Verständnis von Professionalität und "professionellem Handeln" geht von einem sozialwissenschaftlich- soziologischen Verständnis von "Professionen" als einer speziellen Art von Berufen aus, die sich durch Wissenschafts- und Klientenbezug gleichermaßen auszeichnen, die selbst ein hohes Maß an funktionaler Autonomie besitzen, Krisenerfahrungen bearbeiten und auf die (Re-)Autonomisierung ihrer Klient*innen abzielen. Beispiele hierfür sind Ärzte, Juristen, Therapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter. Im Unterschied zu den eingangs skizzierten Professionalitätsmodellen folgen daraus keine Perfektionsmodelle professionellen Handelns, sondern eher Modelle der fallspezifischen Ausgestaltung und Ausbalancierung von Spannungsverhält-nissen und dem professionellen Handeln inhärenten Widersprüchen/Paradoxien: z.B. von Abhängigkeit und Autonomie, Reflexion und Handlungsfähigkeit, Bindung und Entbindung, Rolle und ganzer Person, Organisation und Fallbezug.
Dieses Modell im Anschluss an Talcott Parsons und die Psychoanalyse, Ulrich Oevermann und Werner Helsper gilt es in ihrer Bedeutung für das sonderpädagogische Handeln zu erschließen. Wir werden damit arbeiten und an exemplarischen Problemen, Einzelfällen und Praxisbeispielen deren Potential für die (Reflexion) sonderpäda-gogischer Praxis in den Handlungsfeldern Schule und sozialer Arbeit erproben.
Literatur:
Werner Helsper (2021): Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns: Eine Einführung. Opladen, Toronto (Budrich/UTB)
Bemerkung:
Das Seminar findet durchweg als Präsenzveranstaltung statt. Voraussetzung für die Verbuchung der zwei Kontakt-CP sind drei Original-Unterschriften (Anfang, Mitte, Schluss), die im Seminar eingeholt werden. Prüfungsformen sind Präsentationen +schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeit im Umfang von 2/3 CP), sowie unbenotete und benotete 1-CP-Leistungen nach Absprache mit jmk.
4. Methodenwerkstatt II: Qualitative Methoden. Freitags 12.15 Uhr bis 14.30 Uhr, Raum 8A/003, ab 24.10.2025 (Vorbesprechung)
Etwas über (sonder-) pädagogische Praxis oder Lebenswelten von Schüler*innen, Klient*innen und die sie betreuenden Profis lernen - statt mit Theorie und Literaturrecherchen mal mit eigener Feldforschung? Mit den Leuten sprechen statt über sie? Interviews, Befragungen mit Fragebögen, teilnehmende Beobachtung? Das ist meistens eine gute Idee! Aber wie geht man dabei vor, von der ersten Idee bis zur sorgfältigen Analyse des dabei gewonnenen Materials?
Das Problem ist, dass man Methoden qualitativer und quantitativer Sozialforschung ebenso wenig nach Handbuch erlernen kann wie Autofahren, Fliesenlegen oder Trompete spielen. Die Methodenwerkstätten, von Peter Jauch und Jörg Michael Kastl durchgeführt, sollen gemeinsames „Learning by Doing” aller Teilnehmer*innen ermöglichen – an konkreten Forschungsproblemen und „Datenmaterial” aller Art (z.B. Daten aus Fragebogen-Befragungen, Interviews, teilnehmenden Beobachtungen, Akten und anderen Dokumenten).
Sie richten sich an alle, die etwas über Forschungsmethoden lernen und/oder in eigenen Studienprojekten, Masterarbeiten oder für ihre Dissertation forschen und sich darüber mit anderen austauschen wollen. Es werden zwei Methodenwerkstätten angeboten:
- Peter Jauch übernimmt die Werkstatt mit Schwerpunkt auf quantitativen Methoden (z. B. standardisierte Beobachtungen, Befragungen mit Fragebögen, Evaluationen, statistische Auswertungen mit SPSS u.a.);
- Jörg Michael Kastl übernimmt die Werkstatt mit Schwerpunkt auf qualitativen Methoden (z.B. narrative Interviews, Auswertungen mit objektiver Hermeneutik/Grounded Theory).
Denkbar sind – je nach den Interessen der Teilnehmer*innen - auch phasenweise Kooperationen der beiden Werkstätten/ein Wechsel zwischen beiden Veranstaltungen.
Es können alle Studierenden und Promovierenden, die in irgendeiner Form empirisch arbeiten oder dies vorhaben, ihre Überlegungen, Probleme, Ideen, Forschungsinstrumente, Daten einbringen - zum Beispiel bei kleinen und großen Projekten während des Studiums, im Zusammenhang mit Masterarbeiten, Dissertationsprojekten. Es spielt dabei keine Rolle, in welchem Stadium der Überlegungen Sie sind. Die Veranstaltung lebt von der Diskussion in der Gruppe, wir legen großen Wert auf die Diskussion von allen mit allen. Ausgangspunkt sind stets die sich konkret stellenden Forschungsprobleme.
Die Werkstätten sind offen für alle Studierende der Fakultät für Teilhabewissenschaften und der Pädagogischen Hochschule insgesamt, die etwas über Methoden lernen wollen. Für Studierende, die von Peter Jauch oder/und Jörg Michael Kastl bei Abschluss- oder Projektarbeiten mit empirischen Anteilen betreut werden, ist ein Besuch verbindlich.