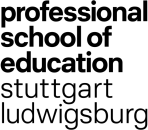- Hochschule
- Hochschule
- Profil
- Aktuelles
- Veranstaltungskalender
- Zentrale Gremien und Leitung
- Fakultäten
- Verwaltung
- Einrichtungen
- Einrichtungen
- Hochschulbibliothek
- Zentrum für Medien und Informationstechnologie (MIT)
- Bild- und Theaterzentrum (BTZ)
- Didaktische Sammlungen
- ForBi
- International Office
- Kompetenzzentrum für Bildungsberatung (KomBi)
- Makerspace
- Professional School of Education Stuttgart - Ludwigsburg (PSE)
- Sprachdidaktisches Zentrum
- LIFT - Ludwigsburger interdisziplinäres Zentrum für Forschung und Transfer
- Zentrum für Literaturdidaktik Kinder Jugend Medien (ZeLd)
- Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung
- Zentrale Ansprechpartner*innen
- Zentrale Ansprechpartner*innen
- Alumninetzwerk
- Campusmanagement
- Datenschutz und Informationssicherheit
- Digital Learning Center
- Gleichstellung
- Hochschulkommunikation
- Nachhaltigkeit und Mobilität
- Personalrat
- Qualitätsmanagement
- Beratung für Behinderte und chronisch Erkrankte
- Sicherheitsbeauftragte
- Strahlenschutz
- Verfasste Studierendenschaft
- Campusleben
- Bauinformation
- Raumkonzepte
- Weltoffene Hochschule
- Angebote für Kinder und Jugendliche
- Studium
- Studium
- Aktuelles
- Veranstaltungskalender
- Vorlesungsverzeichnis
- Studienangebot
- Workshopangebote
- Beratung und Information
- Beratung und Information
- Studieninformationstag
- Fachschaften
- FAQs Studium
- Forschungswerkstatt Bildungswissenschaften (ForBi)
- Informationen für schwangere Studentinnen
- Informationen zum Datenschutz
- Studienabteilung
- Studienberatung
- Internationale Bewerber und Studierende
- Studieren mit Kind
- Studieren mit Beeinträchtigungen
- Soziales, Stipendien und Finanzen
- Sexuelle Grenzverletzung
- Studierenden-Service-Center (SSC)
- Bewerbungsportal
- Bewerbungsportal
- Bewerbung
- Einschreibung/Immatrikulation
- Bewerbungsprozess Lehramts-Master
- Anrechnungsprozess für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester
- Studienorientierungstests
- Auswahlverfahren / Grenzwerte
- Aufnahmeprüfungen Kunst Musik Sport
- Sonderpädagogische Fachrichtungen
- Internationale Studierende
- Studieren ohne Abitur
- Studieninteressierte
- Erstsemester
- Studierende
- Studienorganisation
- Studienorganisation
- Rückmeldung
- Formulare zum Studium
- Adressänderung
- Fachwechsel
- Chipkarte
- Exmatrikulation
- Leistungsnachweis BAföG
- Studien- und Prüfungsordnungen
- Studien- und Prüfungsausschüsse
- Studienfinanzierung/ Stipendien
- Gebühren und Beiträge
- Semestertermine
- Übergang LA-Masterstudium
- Studienbescheinigung
- Besondere Erweiterungsfächer
- Lernräume für Studierende
- Prüfungen
- Prüfungen
- Aktuelles
- Für alle Abschlüsse geltende Informationen zu Prüfungen
- Kontakt
- Kontaktformular Anmeldung bzw. Abgabe von Bachelor-/Masterarbeiten
- Lehramtsstudiengänge
- Weitere Bachelor- und Masterstudiengänge
- Online-Modulprüfungs- und Bausteinanmeldung
- Rücktritt / Studieren mit Kind/ Nachteilsausgleich / Formulare / Anrechnungen
- Promotion und Habilitation
- Schulpraxisamt
- Tutor*innen-Programme
- Studieren in besonderen Lebenslagen
- Hochschule für alle
- Nach dem Studium
- UniNow-App
- Forschung
- Forschung
- Ausschreibungen und Stipendien
- Forschungsprofil und Projekte
- Forschungsförderung
- Wissenschaftliche Karriere
- Veranstaltungsangebote für Austausch, Vernetzung und Qualifikation
- Gremien und Ausschüsse
- Gremien und Ausschüsse
- Forschungsausschuss
- Ethikkommission
- Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen des Fehlverhaltens in der Wissenschaft
- Vertrauenskommission Transparenz in der Drittmittelforschung
- Fakultätsübergreifende Evaluationskommission
- Vergabekommission für Stipendien nach dem LGFG
- Ombudspersonen für Promotionsverfahren
- Promovierendenkonvent
- Team
- Weiterbildung
- International
Drei Fragen an ...

... Kulturmanagerinnen und -manager im Kulturbetrieb!
Auf diesen Seiten stellen wir in loser Reihenfolge Absolventinnen und Absolventen unserer verschiedenen Studiengänge im Berufsleben und in der Wissenschaft vor.

Lieber Herr Bemmé, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Projektmanagement. Diese Kompetenz verändert sich, inzwischen wird häufig von agilem Projektmanagement gesprochen. Worin liegen die Unterschiede?
Manche Vorgehensweisen im agilen Projekttagesgeschäft unterscheiden sich weniger von denen des ‚klassischen‘ Projektmanagements als viele annehmen. So ist etwa ein eher agiles ‚Kanban-Board‘ nur eine Variante der ‚Aktivitäten-Liste‘ im klassischen Projektmanagement. Zugleich steht hinter einer genuin agilen Arbeitsorganisation tatsächlich ein vom klassisch-managerialen Denken und Handeln grundlegend abweichendes Werte-, Denk- und Handlungsmodell. Nehmen im klassischen Projektmanagement die Risikominimierung und Fehlerprävention durch frühe und vollumfängliche Projektplanung viel Zeit und Raum ein, beschränkt sich das agile Handeln auf die akkurate Planung jeweils nur der nächstbekannten Schritte. Fehler im Prozess sind eine bewusst in Kauf genommene Lernchance, sprich, werden als Bereicherung angesehen. Gilt im klassischen Projektmanagement der Leitsatz „Geliefert wie bestellt“ (der Projektvertrag regelt alles), so könnte er im agilen Denken eher „Geliefert wie gewollt“ lauten, das heißt, allein die Auftraggebenden-Freigabe entscheidet.
Was bedeutet das für KulturmanagerInnen: Welche weiteren Kompetenzen sind notwendig, müssen aufgebaut oder gestärkt werden? Und wo liegen die Herausforderungen?
Die Anforderungen zum erfolgreichen agilen Arbeiten adressieren vor allem die Sozial- und Methodenkompetenzen der beteiligten Akteurinnen und Akteure und lassen sich am besten als (sozialer) ‚Reifegrad‘ bezeichnen. Geisteshaltung und gemeinsam geteilter Werterahmen sind hierbei einerseits wünschenswertes Ergebnis agilen Wirkens, andererseits seine Voraussetzung. Hierzu zählen der Wille, die Fähigkeit und die Fertigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ebenso wie der Wille zu Eigeninitiative, Selbstführung und Selbststeuerung, zu Vereinbarung und Vereinbarungstreue auf Basis gemeinsam geteilter Spielregeln. Das braucht den Mut der beteiligten Letztverantwortlichen, den Raum für teilautonomes, selbststeuerndes Arbeiten bewusst zu schaffen und die Resultate anschließend akzeptieren, aushalten und wertschätzen zu können. Insofern lässt sich sehr verkürzt sagen, dass sich agiles Arbeiten nicht sonderlich gut mit autoritären funktionshierarchischen Entscheidungsstrukturen oder rein direktiven Führungsdenk- und Verhaltensmustern verträgt.
Kann der Ansatz des agilen Projektmanagements auch in öffentlichen Kulturbetrieben funktionieren?
Einzelne Vorgehensweisen können auch in öffentlichen Kulturbetrieben Anwendung finden. Sinnvoll wäre zum Beispiel, die über Jahrzehnte etablierten Besprechungsrituale durch häufigere (etwa tägliche) und einzelergebnisfokussierte Meetings (‚Daily Stand-ups‘) zu ersetzen und sie dafür auf eine Viertel- oder halbe Stunde zu begrenzen. Die vollständige Adaption eines agilen Mind-Sets wird wiederum vermutlich schwierig und ist womöglich auch nicht die probate Antwort auf alle Fragen. In einer traditionell auf Stabilität, Zuverlässigkeit, Wiedererkennbarkeit von Prozessen und Entscheidungswegen aufgebauten Umgebung ist das Bewusstsein für die Potenziale kollektiver Entscheidungen, für geteilte Verantwortung, für eine hohe Leistungsabnehmerinnen- und -nehmer-Orientierung und für eine Kultur der Zielvereinbarung vermutlich weniger ausgeprägt.
Die Fragen stellte Dr. Petra Schneidewind

Lieber Herr Bensch, Sie sind Leiter der Abteilung Kultur und bürgerschaftliches Engagement der Stadt Tuttlingen. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Nach gut acht Jahren Kulturabteilungsleitung wurde mir zu Jahresbeginn 2022 vom Gemeinderat die Fachbereichsleitung Schulen, Sport und Kultur übertragen – die Kultur bekommt künftig also noch zwei thematische Geschwister! Die Faszination im Kulturbereich liegt für mich aber nach wie vor in den Gestaltungsmöglichkeiten, da wir in Tuttlingen dank vergleichsweise rosiger örtlicher Rahmenbedingungen viele Ideen mit den verschiedensten Projektpartnern umsetzen können – wenn nicht gerade Pandemiebekämpfung wichtiger ist. Insbesondere Projekte mit Schulen, Vereinen und Organisationen sorgen für immer neue Impulse und Erfahrungen, und zwar für alle Beteiligten.
Sie haben Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz sowie Kulturmanagement in Ludwigsburg studiert. Haben Sie Ihr Studium bewusst auf einen Berufswunsch ausgerichtet?
Absolut. Ich komme aus einem politischen Elternhaus, weswegen einem politischen Engagement von Anfang an Tür und Tor offenstanden; entsprechend habe ich früh politische Willensbildungsprozesse erleben und mitgestalten dürfen. Da half und hilft mir wohl auch die Selbstwirksamkeitserfahrung auf kommunaler Ebene, mit der Sinnfrage umzugehen. Neben diesen politischen und philosophischen Fragen fasziniert mich auch dieses schwer greifbare und kaum beschreibliche Phänomen, mit der reinen Schönheit in Berührung zu kommen, wie ich es erlebe, wenn ich etwa Ibrahim Maalouf höre, den ich sehr empfehle. Gerade in Kunst und Kultur zu erleben, zu welch unfassbar schönen Werken der Mensch in der Lage ist, gibt Hoffnung, um nicht aufzugeben, zum Zyniker oder Opportunisten zu werden, sondern – so anstrengend es auf Dauer sein mag – sich für eine für alle Menschen lebenswerte Zukunft einzusetzen und für das zu arbeiten, was diesem Ziel dient. To be continued…
Dem Kulturbetrieb wird immer wieder geraten, er solle sich mehr von öffentlichen Modellen der Finanzierung lösen. Wie blicken Sie mit Ihrer Expertise auf diese Forderung?
Aus betrieblicher Sicht ist die ergänzende Erschließung neuer Kanäle zur Beschaffung von Ressourcen sicher ratsam, ungeachtet des Drucks auf öffentliche Haushalte. Sprich: das eine tun, ohne das andere zu lassen, wobei es im Kulturbetrieb durchaus einen Unterschied macht, ob ich ein großes Theater, eine e.V.-Musikschule oder eine öffentliche Bibliothek im Kopf habe. Ich würde nämlich trotz aller vielversprechenden Möglichkeiten der Mittelakquise die Politik nicht zu leicht aus der Verantwortung lassen, denn den öffentlichen Kulturauftrag gibt es ja. So ist Sponsoring sicherlich vieles, aber eben nicht zwingend krisensicher, wie es der FC Chelsea derzeit deutlich feststellt. Solange unsere Programme wirken und sich rechtfertigen, ist nach meinem Dafürhalten die Kultur ein großartiger Bereich, um öffentliche Mittel sinnvoll und zilegerichtet einzusetzen. Wer nicht an die Legitimität, Wirkung und Wichtigkeit der eigenen Angebote glaubt, wird es sicherlich im Verteilungskampf um Ressourcen schwer haben. Für mich ist es unbestritten, dass Kunst und Kultur einen sehr wertvollen Beitrag für das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger leisten können und sollten.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch

Lieber Herr Lohnert, Sie sind Musiker und Manager – letzteres hat Sie an die Spitze der Stuttgarter Messe geführt. Musik und Messe: Gibt es etwas, das beide Felder verbindet?
Es gibt durchaus Parallelen zwischen einem guten Musikstück und einer Messe. Als Musiker und Künstler betrachte ich Messen ebenso als Bühnen. Sie bieten Plattformen für Aufführungen unterschiedlichster Art. Wie ein gutes Schauspiel oder eine Oper, hat jede Messe ihre eigene Dramaturgie, eine besondere Inszenierung, eine Botschaft und ein Publikum. Die ‚Botschaft‘ einer Messe sind die gezeigten Innovationen und Produktweiterentwicklungen. Das ‚Publikum‘ sind die Besucherinnen und Besucher. Die Interpretation des Messethemas kann, wie bei der Musik auch, höchst unterschiedlich sein. Und am Ende steht der Applaus: das Brot des Künstlers, die Quittung für die dargebotene Attraktivität. Bei Messen wird dieser Applaus gemessen an einer Wiederausstellungsabsicht der Ausstellenden und der Wiederbesuchs- und Weiterempfehlungsabsicht der Besucherinnen und Besucher. Informationen, die wir aus unserer Aussteller- und Besucherbefragung generieren.
Sie haben in Ludwigsburg studiert: Welche Bedeutung hatte diese Zeit für Sie? Woran denken Sie (besonders) gerne zurück?
Ich gehörte seinerzeit zu den ersten Studierenden. Der Studiengang "Öffentliche Kulturarbeit und Kulturmanagement" war neu und wurde berufsbegleitend als Pilotprojekt angeboten, heute ist er als Vollzeitstudium etabliert. Wir waren so um die 16 bis 18 Studierende, ein ziemlich bunter Haufen. Was als eine Art Kaderschmiede in diesem Bereich gedacht war, hat höchst unterschiedliche Karrieren in Politik, Kultur und Messewesen hervorgebracht. Die Netzwerke bestehen bis heute fort, wir tauschen uns untereinander immer noch aus. Mir hat das Studium die notwendigen Ressourcen für meinen jetzigen Beruf vermittelt: umfangreiches Wissen in den Bereichen Projektmanagement, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Marketing, Kommunikation und Vertragswesen. Als Musiker hat man von diesen Themen meist wenig Ahnung.
Was würden Sie einem jungen Kulturmanager raten: Was am allgemeinen Management, das Sie heute betreiben, ist auch fürs Kulturmanagement besonders wichtig?
Unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliches Handeln sind unumgängliche Skills, die man im Management mitbringen muss. Sie bilden die Basis. Nonstop Netzwerken - und zwar über den Kulturbereich hinaus - ist notwendig als Überbau, um Weitblick zu generieren und ein bis zwei Mentorinnen oder Mentoren zur Unterstützung zu gewinnen. Unerlässlich ist es zudem, multioptional aufgestellt zu sein. Ein Produkte-Mix ist essentiell, Flexibilität in unserem Business ein Muss. Es wäre zu riskant, nur auf ein Pferd zu setzen.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Liebe Frau Göhner, Sie verantworten erstmals die Internationale Kulturbörse in Freiburg. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Vorweg einige Informationen zur Internationalen Kulturbörse Freiburg (IKF): Die IKF ist eine Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events. Mit ca. 200 Live-Auftritten auf fünf Bühnen aus den Bereichen Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater, 400 Ausstellenden und über 4500 Fachbesucherinnen und -besuchern gehört sie zu den wichtigsten und zentralen Foren der Kultur- und Eventbranche im deutschsprachigen Raum. Sie wurde 1989 gegründet und findet vom 26. bis zum 29. Januar 2020 zum 32. Mal statt. Als Kulturmanagerin reizt mich hier die Bandbreite des Aufgabenspektrums und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten: So gehören zu meinen Tätigkeiten unter anderem die Erstellung und Überwachung des Budgets, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Ausbau und Aufbau unserer verschiedenen Netzwerke, ebenso wie die Akquise neuer Messebesucher und Künstler. Momentan sind wir dabei, ein neues Corporate Design für die IKF zu entwickeln und umzusetzen.
Inwiefern hat Sie das Ludwigsburger-Studium auf Ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet?
Ich habe sehr viel über Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und über Projektmanagement gelernt. Auch die Auseinandersetzung mit kultursoziologischen und -politischen Fragestellungen während des Studiums war für meine weitere berufliche Laufbahn wichtig.
Wenn Sie jüngeren Kulturmanagerinnen und -managern einen Rat geben sollten: Worauf kommt es im Kulturbereich an - allgemein und bei einer Leitungsaufgabe wie der Ihrigen?
Wichtig ist für mich, offen für Veränderungen zu bleiben. Insbesondere gilt es, gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf den Kulturbereich im Blick zu haben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Seit einigen Jahren findet ein generationsbedingter Wechsel in der Veranstaltungsbranche statt. In diesem Zusammenhang müssen wir uns als Veranstalter überlegen, wie wir die nachwachsende Generation der Kultur- und Eventfachleute erreichen und wie wir das Programmangebot für die neue Generation attraktiv gestalten können. Bei einer Leitungsaufgabe im Kulturbereich kommt es für mich unter anderem darauf an, eine klare Vorstellung davon zu haben, wohin ich mein Projekt in der Zukunft entwickeln möchte. Ferner gehört für mich die Fähigkeit dazu, ab und an einen Perspektivwechsel vornehmen zu können und mich in die Bedürfnisse meiner Zielgruppen hineinzuversetzen.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Welche Herausforderungen warten auf die PR großer Kultureinrichtungen in den nächsten Jahren?
Auch wenn man da als Ludwigsburger Kulturmanager vermutlich Hausverbot bekommt: Große Kultureinrichtungen möchten – auch bedingt durch ihren Auftrag – wenn nicht alle, so doch möglichst viele Menschen erreichen. Fakt ist, dass sich die Öffentlichkeit zunehmend zersplittert, vor allem in punkto Medienverhalten. Über gedruckte Zeitungen, die lange die Leitmedien in der PR waren, erreiche ich Publikum unter 30 oder mit Migrationshintergrund kaum. Folglich muss ich mir neue Kanäle suchen, hier spielen auch Multiplikatoren wie Peer Groups eine immer wichtigere Rolle. Ich denke, dass kein Medium in den nächsten Jahren ein anderes komplett ersetzen wird, und man hier breit aufgestellt sein muss. Ebenso wichtig ist es, die Besucherinnen und Besucher nach Special Interests aufzuteilen. Wir machen das schon seit Jahren und haben sie nach geografischen Interessen (Afrika, Ostasien etc.) oder Formatvorlieben (Aktionsprogramme, Vorträge etc.) segmentiert, so dass wir sie ganz gezielt auf die für sie spannenden Termine ansprechen können.
Das Linden-Museum postet und twittert, um junge Besucher zu erreichen. Ist das der Weg in die Zukunft?
Wir schätzen soziale Medien sehr für die Möglichkeiten, die sie bieten: das Museum hinter den Kulissen zu präsentieren, zu zeigen, was die Kolleginnen und Kollegen hier täglich machen, oder auch mal „live“ von einer Veranstaltung zu twittern. Zentral sind Austausch und Vernetzung, die bei uns über Twitter eine sehr starke internationale Ausprägung haben. Soziale Medien sind damit sicherlich ein Weg unter vielen, um neue Besuchergruppen zu gewinnen – wobei man ganz klar feststellen muss: Nur weil ich bei Facebook, Twitter oder YouTube bin, erreiche ich nicht automatisch junge Leute. Will sagen: Wenn die Inhalte und die Angebote, die ich mache, „alt“ sind, nützt auch das hipste Medium nichts.
Welche Rolle spielen narrative Vermittlungsansätze für die PR der Zukunft?
Museen sollten grundsätzlich immer Objekte zum Sprechen bringen und Geschichten erzählen. Geschichten vermitteln auf lebendige Weise Wissen und unterhalten. Was Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung fesselt, funktioniert auch bei Journalisten oder Bloggerinnen, die ihre Leserinnen und Leser ja auch nicht mit drögen Fakten füttern möchten. Und das Schöne daran: Gute Geschichten werden immer weiter erzählt.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Lieber Herr Raithel, was zeichnet für Sie den Kulturstandort Ludwigsburg aus?
Ludwigsburg ist trotz seiner überschaubaren Größe und der Nähe zu Stuttgart lebendig und vielseitig. Die Ludwigsburger Schlossfestspiele und das Residenzschloss mit seinen Museen gehören sicherlich zu den Highlights. Aber auch das Kunstzentrum Karlskaserne als kreatives Ausbildungs- und Produktionszentrum, das städtische Kulturprogramm im Forum am Schlosspark oder die liebevoll geführten Programmkinos sind ausgewiesene Stärken. Kulturpolitisch hat die Stadt mit dem Bau der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg neben der Filmakademie und der Eröffnung des MIK als Dach von Kunstverein, Stadtmuseum und Tourist Information Mut und Weitblick bewiesen. In letzter Zeit beobachte ich allerdings eine gewisse Verwässerung von Profilen. Auch die Diskussion um die so genannte Kulturelle Bildung steht häufig zu stark im Fokus. Die Orientierung an Qualität darf nicht verloren gehen. Spielräume für Projekte, für Experimente sollten erhalten und ausgebaut werden. An manchen Stellen würde ich mir mehr Aufrichtigkeit und Mut zum großen Wurf wünschen. Ich vermisse vor allem beim Stadtmarketing ein Bekenntnis zur Kulturstadt Ludwigsburg. – Dennoch ist Ludwigsburg eine wunderbare Stadt mit vielen Möglichkeiten!
Die Karlskaserne beherbergt verschiedene Kultureinrichtungen. Welche Rolle wird Ihnen in diesem Verbund zuteil?
Im Wesentlichen geht es um die Organisation von Abläufen, um Belegungen, den Spielplan, um Kommunikation, Vermittlung zwischen den Interessen, um Lobbyarbeit für die ansässigen Kultureinrichtungen. Eine aktuelle Frage ist etwa, wie sich die Karlskaserne als außerschulischer Lernort positioniert. Eine permanente Aufgabe ist die bauliche und finanzielle Weiterentwicklung. Kurzum: Es geht um die Ermöglichung von Kunst und Kultur.
Die Kunstschule Labyrinth, die Jugendmusikschule, die Junge Bühne und weitere Initiativen widmen sich der Kulturellen Bildung. Vor welchen Herausforderungen stehen sie?
Alle Einrichtungen fragen sich, wie sie sich angesichts grundlegender Veränderungen an Kindergärten und Schulen in Position bringen bzw. neu erfinden. Mit welchem Konzept und unter welchen Voraussetzungen gehen wir an die Schulen? Wie schaffen wir es, unser Kerngeschäft und unseren Qualitätsanspruch zukunftsfähig zu machen und unsere Einrichtungen auch finanziell aufrecht zu erhalten? Denn (künstlerische) Qualität hat ihren Preis!
Die Fragen stellte Dr. Yvonne Pröbstle.

Liebe Frau Irmer, Sie sind seit dem Jahr 2008 an der Komischen Oper tätig. Was reizt Sie an diesem Haus? Was macht die Komische Oper für Sie aus?
Ich bin eher zufällig hier gelandet, aber ich habe das Haus lieben und schätzen gelernt. Es ist in jedem Fall ein besonderes Haus, das sich von den beiden anderen Berliner Opernhäusern stark unterscheidet. Unser Programm ist vielfältiger, und das spiegelt sich auch im Publikum wider, ebenso wie in unserem Förderkreis. Ich würde sagen, dass sich diese Vielfalt selbst bei den Kolleginnen und Kollegen zeigt. Diese Vielfalt macht meine Aufgabe etwas schwieriger, aber auch interessanter. Das nicht homogene Publikum ist eine Herausforderung bezogen auf das Spendenverhalten und die Angebote für die oft völlig unterschiedlichen Menschen. Gleichzeitig erlebe ich, dass viele unseren Förderkreis sehr attraktiv finden, weil hier eben nicht alle über 70 und und im gleichen Club sind. Insgesamt liebe ich die Lebhaftigkeit in diesem Haus und die Musik, die mich letztendlich auch hergeführt hat.
Wie sieht Ihr Aufgabenfeld als Leiterin des Förderkreises und Referentin für Sponsoring konkret aus?
Meine Arbeit ist ein Mix aus Veranstaltungs- und Reisemanagement, Spendenverwaltung und -akquise, allgemeiner Verwaltungstätigkeit (Buchhaltung, Jahresabschluss etc.), Psychologie – das Einstellen und Einfühlen in die vielen unterschiedlichen Menschen ist sehr wichtig – und Kommunikation: das Erstellen und Verfassen von Publikationen wie dem Newsletter, die Pflege der Website, die Beantwortung von E-Mails, das Telefonieren oder die persönliche Begegnung mit Förderern nehmen einen Großteil des Arbeitsalltags ein. Das ist zeitinensiv, trägt aber definitiv zur Bindung der Menschen bei und führt so auch zu höheren Spenden und mehr Engagement.
Die Komische Oper praktiziert die Kommunikation mit einem interkulturellen Publikum. Inwiefern ist davon auch Ihr Bereich betroffen? Wo sehen Sie die großen Herausforderungen der Zukunft?
Wir haben festgestellt, dass dieser zunächst gar nicht so einfach zu kommunizierende Aspekt zum Favoriten bei der Akquise von Drittmitteln geworden ist. Wenn wir neue Partner suchen, ist unser Projekt Selam Opera! sehr gefragt, mittlerweile werden wir sogar konkret darauf angesprochen. Es gibt Förderer, die auf Feiern für diesen Zweck eigeninitiativ Spenden sammeln, was uns sehr freut! Außerdem haben wir internationale Förderkreismitglieder – die bei uns höchste Förderstufe – unter anderem eine türkische Kuratorin. Der Anfang war schwer, aber wir haben nicht aufgegeben und immer daran geglaubt! Eine Herausforderung für die Zukunft ist, unseren Förderkreis noch bunter und jünger werden zu lassen, noch mehr Gelder für die Oper zu akquirieren und das Thema Erbschaftsfundraising erfolgreich zu etablieren.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Lieber Herr Wall, neben Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer einer Stiftung, als Kunstberater und Kurator sind Sie im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst als Leiter des Forums „Digitale Welten“ beteiligt. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
In diesem Dialog wurde allen Beteiligten klar, dass Digitalisierung im Kulturbetrieb mehr ist als die Digitalisierung der bestehenden Verhältnisse. Digitalität geht sehr viel tiefer in die Strukturen der Institutionen, sie verändert diese grundlegend. Alle Bereiche einer Institution, von der Wissenschaft bis hin zur Kommunikation und Verwaltung, sind von diesen neuen Bedingungen betroffen, allen voran der Umgang mit den Besucherinnen und Besuchern. Digitalität braucht letztendlich einen Bewusstseinswandel sowohl bei den Mitarbeitenden als auch den Führungskräften. Dieser Wandel ist natürlich auch mit infrastrukturellen Herausforderungen verbunden (Technik, Software etc.) und ist ein Prozess, der nie zu einem Ende kommen wird. Wir müssen uns auf ein kontinuierliches Weiterentwickeln in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einstellen. Es hat sich im Prozess aber noch ein weiterer, vielleicht noch wichtigerer Punkt herauskristallisiert: Wir müssen die digitalen Entwicklungen vor dem Hintergrund unseres aufklärerischen Erbes einordnen und bewusst gestalten.
Was sind Ihrer Einschätzung nach die Qualitäten, die eine Kulturmanagerin oder ein Kulturmanager unter diesen Voraussetzungen mitbringen sollte?
Eine wichtige Qualität ist, unabhängig von der inhaltlichen Kompetenz, große Offenheit – und zwar nicht nur gegenüber unterschiedlichen Themen, sondern auch gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. Es hat sich gezeigt, dass sich die Deutungshoheit in den Institutionen durch die digitalen Möglichkeiten verschoben hat. Die Zeiten, in denen die Kulturinstitutionen festgelegt haben, was das Wahre, Gute und Schöne ist, sind zu Ende. Themen und Präsentations- und Darstellungsformen müssen gemeinsam mit dem Publikum entwickelt werden. Nur so wird man in Zukunft in der Lage sein, es interessiert zu halten und die gesellschaftliche Relevanz der Kulturinstitutionen aufrecht zu erhalten. Außerdem sollte man als Kulturmanager in der Lage sein, die Kulturarbeit im oben angedeuteten gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu sehen. Es geht um die Zukunft unserer bürgerlichen Gesellschaft.
Sie haben am Institut für Kulturmanagement zum „unmöglichen Museum“ promoviert. Inwiefern hat Sie das in Bezug auf Ihre jetzigen Tätigkeiten geprägt?
Mein Promotionsthema begleitet mich bis heute, auch wenn sich die Themen, mit denen ich mich in der Praxis beschäftige, natürlich sehr gewandelt haben. Letztendlich geht es in meiner Dissertation um das problematische Verhältnis der Institution zu ihren Inhalten, also vom Kunstmuseum zur Kunst. Mir ist damals aufgefallen, dass die Strukturen der herkömmlichen bürgerlichen Kunstinstitutionen nicht mehr zu der Kunst passen, die sie präsentieren und vermitteln sollen. Aus heutiger Perspektive kann ich sagen, dass ich mich damals schon mit dem grundlegenden Wandel der Institution auseinandergesetzt habe, mit Flexibilisierung, Öffnung, mit dem Verhältnis zu den Betrachtenden. Alles Dinge, die mich weiter beschäftigen und von denen meines Erachtens die Zukunft des bürgerlichen Kulturbetriebs abhängt.
Die Fragen stellte Natascha Häutle M. A.

Liebe Frau Kraft, als Kulturmanagerin und Kommunikatorin sind Sie an der Schnittstelle zwischen kulturellem Erbe und Kulturtourismus tätig. Was macht diese Schnittstelle aus?
Das Besondere an unserer Arbeit ist die Vielfalt der rund 60 historischen Monumente, für die wir zuständig sind. Im Fokus unserer Arbeit steht eine landesweite Familie aus Schlössern, Gärten, Klöstern, Burgen und Kleinodien. Es gibt natürlich touristische Leuchttürme wie Schloss Heidelberg oder Kloster Maulbronn, die in der Vermarktung einen anderen Stellenwert einnehmen, aber von ihnen profitieren die kleineren Monumente mit. Eine weitere Spezifik ist die Tatsache, dass es sich um authentische Originalschauplätze handelt, die bewahrt und geöffnet, aber auch vermittelt und vermarktet werden sollen.
Welche Zielvorgaben haben die SSG für die Vermittlung des kulturellen Erbes in der Region? Welche Rolle spielt die Kooperation mit Touristikerinnen und Touristikern?
In der Vermittlung verfolgen wir das Ziel, das kulturelle Erbe möglichst vielen Menschen nahe zu bringen. Ein Schwerpunkt sind Rundgänge im historischen Kostüm, kulinarische Erlebnisführungen und Programme für Familien. Als strategische Grundlage dienen uns zwei große Besucherbefragungen, aus denen wir Personas und deren Wünsche an einen Besuch abgeleitet haben. Eine große Chance sehen wir in den Möglichkeiten digitaler Anwendungen, mit denen Inhalte monumentverträglich, barrierefrei und spielerisch vermittelt werden können. Grundsätzlich besteht ein enger Austausch mit regionalen Partnern sowie Touristikerinnen und Touristikern. Es werden viele gemeinsame Projekte umgesetzt wie Feste, Märkte oder Veranstaltungen, Messeauftritte oder Aktionen im Bereich des Auslandsmarketings.
Welcher Strategien bedarf es, wenn man als Institution zwischen Denkmalpflege und Erlebnisraum angesiedelt ist: Gibt es ein gelungenes Beispiel?
Die Bewahrung der historischen Monumente ist die Grundlage jeder Präsentation und Vermittlung. Wir versuchen, die Besucherin oder den Besucher auf eine Zeitreise mitzunehmen, ohne die wertvolle Originalsubstanz zu gefährden. Schloss Ludwigsburg hat hierfür erfolgreiche Konzepte entwickelt. Familien sei das Kinderreich empfohlen, in dem sich Kinder verkleiden, auf einen Thron setzen oder im königlichen Bett Geschichten anhören dürfen. Erwachsene können sich bei einer Soirée royale kostümiert durch die Schlossräume bewegen, und nach einem königlichen Menü wird im Marmorsaal zum Tanz gebeten. Durch diese Angebote wird kleinen wie großen Besucherinnen und Besuchern ein individuelles und sinnliches Eintauchen in vergangene Zeiten ermöglicht.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Herr Boll, Sie haben 1999 Ihre Magisterarbeit über Kunstauktionen geschrieben. Heute arbeiten Sie bei Christie's. Haben sich die Ludwigsburger Theorie und die Praxis auf dem internationalen Parkett gut ergänzt?
Die Magisterarbeit und dann vor allem die Dissertation waren für mich entscheidende Schritte der theoretischen und empirischen Durchdringung eines Themas, das mich schon früher aus eigenem Erleben von Kunstauktionen fasziniert hat, wenn auch zugegebenermaßen eher durch Beobachtung und studentische Aushilfstätigkeiten denn als Bieter in Versteigerungen. Zum Glück hat die Freude am Erlebnis durch die theoretische Reflexion keinen Schaden genommen.
Wie hat sich das Berufsbild des Kulturmanagers in den vergangenen 20 Jahren verändert?
Der Kulturmanager ist in einem unvorhergesehenen Maße in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Infolgedessen muss man von ihm erwarten, dass er den professionellen Umgang mit der Öffentlichkeit erlernt und pflegt. Ganz generell ist der steigende Grad an Professionalisierung auch in unserem Metier Herausforderung und Anspruch – was eine wunderbare Werbung für den Ludwigsburger Studiengang ist!
Das Institut feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Wie wird sich, Ihrer Meinung nach, das Berufsbild des Kulturmanagers in den kommenden 25 Jahren entwickeln?
25 Jahre sind ein junges Alter, erst recht in der Zeitrechnung der akademischen Ausbildung. Charakteristisch für junge Ausbildungswege ist deren interdisziplinärer Ansatz, der es ihnen erlaubt, sich sensibel und schnell auf verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen einzustellen. Mit dieser Wachheit und Offenheit muss man auch künftige Absolventinnen und Absolventen ausrüsten, denn sie stellen grundlegende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit in den Kulturbetrieben dar – nicht nur, aber auch in hohem Maße auf den internationalen Kunstmärkten.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Liebe Frau Funck, Sie sind Professorin für Restaurierung an der Kunstakademie in Stuttgart – Ihren Master-Abschluss haben Sie im Kulturmanagement erworben. Wie ergänzen sich Restaurierung und Kulturmanagement?
Das ergänzt sich wunderbar. Kulturguterhalt braucht eine öffentliche Stimme, wir Restauratorinnen sind die FürsprecherInnen von Kunst und Kulturgut. Die Inhalte der Fächer Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Sponsoring/Fundraising und Management aus dem Kulturmanagement helfen besonders dabei.
Was hat Sie bewegt, Kulturmanagement zu studieren? Wie konnten Sie die dort gelehrten Inhalte in Ihren Tätigkeiten konkret einsetzen?
Ich wollte neben meinem FH-Diplom einen Masterabschluss. Kulturmanagement hat mich wegen der vielen Querschnittsthemen gereizt. Aus der Verbindung beider Studiengänge (Diplomstudiengang Restaurierung und Master Kulturmanagement) entstand die Idee, Öffentlichkeitsarbeit mehr als bisher für Restauratorinnen und Restauratoren an Museen zu nutzen und damit unseren Beruf in diesem Feld zu professionalisieren. Diesen „neuen“ und „anderen“ Blick auf die Restaurierung und Vermittlung habe ich erst durch das Studium erlangt und in einer Promotion anschließend vertieft. Dass das Thema aktuell wie nie ist, zeigen zahlreiche Beispiele zu dem Thema wie Sonder- und Dauerausstellungen in Museen, Angebote wie Führungen und Vorträge durch Restauratorinnen und Restauratoren und nicht zuletzt die Etablierung des Europäischen Tags der Restaurierung, der nun jährlich am zweiten Sonntag im Oktober mit interessanten Angeboten der breiten Öffentlichkeit restauratorische Inhalte vermittelt.
Stichwort Arbeiten 4.0: Worauf kommt es heute im Berufsleben junger Restauratoren an? Welche Rolle spielen neue Arbeitsformen, welche die Digitalisierung, und welchen Rat würden Sie geben?
Es kommt als Restaurator nicht nur darauf an, sein Handwerkszeug praktisch und theoretisch zu beherrschen, wissenschaftlich zu arbeiten und sensibel mit den Objekten umzugehen, sondern dies Interessierten zu vermitteln. Das können Besucherinnen, Kollegen, Kundinnen, aber vermehrt auch Politikerinnen und Sponsoren sein. Der Beruf hat sich demnach von der Restauratorin im stillen Kämmerlein hin zur Person in der Öffentlichkeit gewandelt. Auch wenn dadurch weniger Zeit zum Restaurieren bleibt, rate ich, dies als Chance zu sehen, geht es doch um unser aller kulturelles Erbe.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Lieber Herr Eckert, was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit im Musikbetrieb? Welche besonderen Herausforderungen gibt es?
Mit meinem Job konnte ich meine Leidenschaft zur Musik und zu Konzerten zum Beruf machen und bin gleichzeitig in einem der aufregendsten, sich rasant verändernden Bereiche der Musikbranche gelandet – dem kommerziellen Konzertbetrieb. Es ist immer wieder faszinierend, diese Leidenschaft mit so vielen Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Eine große Herausforderung war es, mich ohne tiefergehende Kenntnisse in der Branche zurecht zu finden und in meinem Betrieb frische Akzente zu setzen.
Worin unterscheidet sich Ihre Managertätigkeit im populären Musikbereich von jener im klassischen Musikbetrieb?
Ohne Erfahrungen im klassischen Musikbetrieb aufzuweisen, denke ich, dass man im populären Konzertbetrieb breiter aufgestellt sein muss. Bei uns unterscheidet sich fast jedes Konzert vom anderen, was das Publikum, die Produktion als auch das künstlerische Produkt angeht. Vom kleinen Clubkonzert einer türkischen Darkwave-Band vor 30 Personen bis hin zum Open Air-Konzert eines internationalen Megastars in einem ausverkauften Fußballstadion decken wir ein sehr breites Spektrum ab. Unser Anspruch ist es, für jedes gesellschaftliche Milieu ein passendes Konzert zu veranstalten. Kulturpolitisch gesehen ist die Subventionierung der meisten klassischen Konzertveranstaltungen ein grundlegender Unterschied zu unserer popkulturellen kommerziellen Branche.
Inwiefern hat Sie das Ludwigsburger Studium auf Ihre Tätigkeit im Musikbereich vorbereitet?
Meine Tätigkeitsfelder in unserem Betrieb sind vielfältig. Vom Booking, also der künstlerischen Programmgestaltung, dem übergeordneten Projektmanagement der gebuchten Konzerte bis hin zur kalkulatorischen Planung oder dem Onlinemarketing im Speziellen muss ich generalistisch aufgestellt sein. Dementsprechend kann ich verschiedenste Inhalte, auf die mich mein Studium in Ludwigsburg vorbereitet hat, praktisch anwenden. Für die Zukunft würde es mich freuen, wenn der kommerzielle populäre Konzertbetrieb sich stärker im Lehrplan des Instituts wieder finden würde.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.

Lieber Herr Heideker, Sie waren lange als Künstler tätig, bevor Sie ins Fach des freien Kulturmanagers wechselten und eine Agentur gründeten. Es sind derzeit keine leichten Zeiten für selbstständige Kulturmanager. Wie geht es Ihnen?
Es geht mir gut – gesundheitlich wie beruflich.
Bei letzterem kommt es sehr darauf an, wie man mit Herausforderungen umgeht. Natürlich hat die Pandemie dazu geführt, dass ich neue Schwerpunkte in meinem Portfolio gesetzt habe. Vor Corona war ich fast ausschließlich im Live-Event-Bereich (Klassik) tätig, insbesondere Projektentwicklung, -leitung und -finanzierung, Personalleitung sowie Marketing und Pressearbeit. Und natürlich als Künstler und Veranstalter. Durch Corona entstand ein sehr großer Bedarf nach Online-Inhalten. Wo ich vorher nur als Fotograf tätig war, habe ich die Bild-, Ton- und Videoproduktion ausgebaut. Dabei bin ich auch Risiken eingegangen. Gleichzeitig habe ich die durch Absagen frei gewordene Zeit für Bildung genutzt. Meine Lernkurve im letzten Jahr war steil. Da ist die Krise ein echter persönlicher Gewinn für mich gewesen. Auch die finanziellen Hilfen von Bund und Land kamen bei mir problemlos an. Und obwohl ich die durch Corona verursachten Ausfälle nicht ganz kompensieren konnte, haben sich wertvolle neue Möglichkeiten und Kontakte erschlossen.
Sehen Sie, neben all den Risiken, auch Chancen? Was sind Ihrer Einschätzung nach Qualitäten und Eigenschaften, die eine Kulturmanagerin derzeit über Wasser halten?
Ganz klar die Vielseitigkeit. Als Manager habe ich mich schon immer als Generalist verstanden. Das kommt mir jetzt zugute, da ich Dienstleistungen auf vielen Ebenen anbieten kann. So wurde ich gebeten, den Wahlkampf eines Bundestagskandidaten zu managen, Video-Masterclasses zu produzieren oder die Produkte einer Ölmühle für deren Online-Shop zu fotografieren. Gleichzeitig werde ich aber auch als Künstler gebucht oder berate Unternehmen aus dem (kunstfernen) produzierenden Gewerbe in Sachen Personalführung. Die Anpassung des eigenen Angebots an die Erfordernisse des Marktes, das Suchen nach und das Umsetzen von neuen Lösungen sind für mich vergleichbar mit der Lösung von Problemen bei der Leitung eines internationalen Opernfestivals – also Managementaufgaben. Und als ein Freund mich fragte, ob ich ihm im Weihnachtsgeschäft im Versand helfen kann, da habe ich sofort zugesagt – Konzerte waren schließlich alle abgesagt. Chancen gibt es also immer!
Sie haben am Institut für Kulturmanagement das Kontaktstudium besucht. Hat das Studium Ihren Blick für Ihre jetzigen Tätigkeiten geschärft, vielleicht auch geprägt?
Absolut. Durch das Kontaktstudium wollte ich ursprünglich „nur“ finanzielle Verluste bei der Gründung einer Konzertreihe vermeiden. Ich wollte als Künstler ohne manageriales Vorwissen nicht blauäugig in die Projektplanung gehen. Im Ergebnis hat sich mir ein ganzes Berufsfeld erschlossen. Dadurch habe ich nicht nur in Pandemiezeiten mehrere Standbeine. Und der Künstler in mir weiß: Man muss immer flexibel sein.
Die Fragen stellte Dr. Christiane Dätsch.
Ludwigsburg
Reuteallee 46
D-71634 Ludwigsburg
Postfach 220
71602 Ludwigsburg