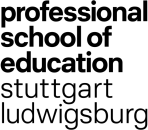Der Senat ist sehr verwundert, dass die aktuellen Überlegungen, die wir weitestgehend aus der Presse erfahren, nicht mit Expert*innen für Bildungsfragen und Lehrer*innenbildung besprochen werden. Uns ist der eklatante Lehrer*innenmangel insbesondere in Grundschulen bewusst. Wir sind selbstverständlich gerne bereit, konstruktiv an einer Lösungsfindung mitzuarbeiten. An den bisherigen Vorschlägen sehen wir hingegen Probleme, die sich langfristig negativ auf die Qualität des Bildungswesens in Baden-Württemberg auswirken können, was exemplarisch an der Grundschule aufgezeigt werden soll: Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass sowohl für den Erwerb des basalen Lesens und Schreibens als auch für das Rechnenlernen ein umfangsreiches Professionswissen bei Lehrkräften unabdingbar ist (u.a. Abraham, 2018; Baumert & Kunter, 2011). So zeigt sich bspw., dass leistungsstarke Kinder unabhängig vom Unterricht flexible Rechenkompetenzen entwickeln, Kinder im durchschnittlichen Niveaubereich noch das (mechanische) Rechnen unabhängig davon erlernen können, jedoch Kinder mit Lernschwierigkeiten in diesen (Teil-) Bereichen das Rechnen nur mit Hilfe eines fundierten qualitativ-guten Unterrichts erlernen können (u.a. Heinze et al., 2009; Rechtsteiner-Merz, 2013; Torbeyns et al., 2009).
Hinzu kommt, dass nahezu die Hälfte der Kinder an Grundschulen Deutsch als Zweitsprache erwirbt und Lehrkräfte aller Fächer auch bezüglich Sprachaneignungsprozessen professionalisiert sein müssen (Jeuk 2021). Unverzichtbar ist weiter der Anspruch einer grundlegenden Bildung, die zusätzlich zu den Fächern und Kompetenzbereichen insbesondere auch die Persönlichkeitsförderung von Kindern in einer spezifischen Altersgruppe im Blick hat (DGfE 2021, Leopoldina 2021). Sowohl im fachdidaktischen als auch im pädagogisch-psychologischen Bereich weisen Quereinsteiger*innen signifikant schlechtere Kompetenzen als Referendar*innen mit Lehramtsstudium auf (Kleickmann & Anders, 2011). Gesellschaftliche Anforderungen an Bildung, wie die Digitalisierung, die inklusive Bildung und Didaktik sowie die individuelle Förderung bei beeinträchtigten Lerndispositionen (z.B. durch Armut, sozio-ökonomische Benachteiligung oder Behinderungen) erfordern sehr kompetente Lehrpersonen. So zeigt sich seit Jahren ein dringender Entwicklungsbedarf insbesondere in der Inklusion (Merz-Atalik, 2022) und im Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg (vgl. Wendt et al. 2019), der nur mit einer fundierten Professionalisierung der Lehrkräfte bewältigt werden kann. Vor diesem Hintergrund irritiert es den Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg besonders, dass ein Direkteinstieg in das Lehramt Grundschule ohne Masterabschluss und Referendariat erfolgen soll. Damit wird das Lehramt Grundschule – nach der Entscheidung für einen zweisemestrigen Master – wiederholt degradiert. Problematisch erachten wir auch Überlegungen zu einem dualen Lehramtsstudium, wenn sie auf eine „Ent-Wissenschaftlichung“ der Lehrer*innenbildung in Baden-Württemberg zielen.
Zur Behebung des Lehrkräftemangels bedarf es aus Sicht des Senats der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg kurz-, mittel- und langfristiger Anstrengungen in Politik, Schule und Hochschule.
Kurzfristige Maßnahmen:
- Seiten-, Quer- und Direkteinsteiger*innen können im Schulalltag helfen, wenn sie fundiert durch die lehrerbildenden Hochschulen wissenschaftlich und professionsorientiert vorbereitet werden.
- Lehramtsstudierende können Schulen bis zu einem gewissen Umfang unterstützen, hier liegen aus dem Projekt „Lernen mit Rückenwind“ bereits gute Erfahrungen vor.
- Personen mit einem BA-Abschluss in einem unterrichtsrelevanten Fach können an den lehrerbildenden Hochschulen in einem Theorie (Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften) und Praxis integrierenden Ein-Fach-Master für dieses Unterrichtsfach qualifiziert werden. Dazu haben die Pädagogischen Hochschulen bereits ein Modell ausgearbeitet.
Mittelfristige Maßnahmen:
- Ein zweiter Einstellungstermin in den Vorbereitungsdienst kann Lehrkräfte schneller in die Schulen führen sowie den Schwund an Absolvent*innen reduzieren, die nach dem erfolgreichen Studienabschluss nicht mehr in den Vorbereitungsdienst gehen, da sie zwischenzeitlich gute Angebote aus anderen Arbeitsbereichen erhalten und annehmen.
- Eine angemessene und gleichgestellte Besoldung aller Lehrkräfte kann dazu beitragen, den Lehrberuf gerade in der Grundschule wieder attraktiver zu machen. Daher schließt sich der Senat der Forderung der GEW sowie des Landesvorstands der Grünen nach A13 für Grundschullehrkräfte an.
Langfristige Maßnahmen:
- Die langfristige Lösung muss es sein, junge Menschen vermehrt dazu zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen und ein grundständiges Lehramtsstudium aufzunehmen. Dazu müssen sich auch die Arbeitsbedingungen und Ausstattungen an den Schulen verbessern, inklusive des Ausbaus von interdisziplinären Personalressourcen (z.B. nicht-lehrende Fachkräfte für Digitalisierung und Inklusion). Lehrkräfte müssen wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgaben, den Unterricht, haben.
Wir erachten es angesichts der Dimensionen der mit den kursierenden Vorschlägen verbundenen Folgen für unabdingbar, eine öffentliche Debatte unter Beteiligung aller beteiligten Akteur*innen zu führen. Dazu müssen alle Pläne und Überlegungen, in welchem Stadium der Planung sie sich auch befinden mögen, auf den Tisch. Wir fordern deshalb einen Runden Tisch zur Lehrkräftebildung in Baden-Württemberg.
Literatur:
- Abraham, U. (2018). Kompetenzen und Standards für den Deutschunterricht. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 70, 4. https://doi.org/10.1515/zpt-2018-0055
- Baumert, J. & Kunter, M. (2011). Das mathematikspezifische Wissen von Lehrkräften, kognitive Aktivierung im Unterricht und Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV. Münster [u.a.]: Waxmann
- DGfE (2021). Grundschulbildung unter den Bedingungen einer Pandemie – und danach. Stellungnahme der DGfE-Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe. Eigenverlag. https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek05_SchPaed/GFPP/2021_GSF_Stellungnahmepapier_Pandemie.pdf
- Heinze, A., Marschik, F., Lipowsky, F. (2009). Addition and subtraction of three-digit numbers: adaptive strategy use and the influence of instruction in German third grade. In ZDM Mathematics Education 41, 591-604. https://doi.org/10.1007/s11858-009-0205-5
- Jeuk, S. (2021). Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Stuttgart: Kohlhammer
- Kleickmann, T. & Anders, Y. (2011). Lernen an der Universität. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV. Münster [u.a.]: Waxmann
- Leopoldina (2021). Kinder und Jugendliche in der Coronavirus‐Pandemie: psychosoziale und edukative Herausforderungen und Chancen. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Eigenverlag. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf
- Merz-Atalik, K. (2022). Canada as a “Driving Force” for Inclusion Activists in European Countries? In T.M. Christou, R. Kruschel, K. Merz-Atalik & I.A. Matheson (Hrsg.), European Perspectives on Inclusive Education in Canada: Critical Comparative Insights (S. 9-34). Taylor & Francis: Routledge Research in International and Comparative Education.
- Rechtsteiner-Merz, Ch. (2013). Flexibles Rechnen und Zahlenblickschulung. Entwicklung und Förderung von Rechenkompetenzen bei Kindern, die Schwierigkeiten beim Rechnenlernen zeigen. Waxmann.
- Torbeyns, J., De Smedt, B., Ghesquière, P. & Verschaffel, L. (2009). Acquisition and use of shortcut strategies by traditionally schooled children. Educational Studies (71), 1–17. http://dx.doi.org/10.1007/s10649-008-9155-z
- Wendt, H. & Hußmann, A. (2019). Leistungsstark und gerecht? Entwicklungen von Grundschulsystemen im europäischen Vergleich. Tertium Comparationis. Journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft , 25(1), 4–27.
Auch das Studierendenparlament äußerte Bedenken und Kritik hinsichtlich der Quer- und Direkteinstiege in den Lehrerberuf:
Resolution des Studierendenparlaments (pdf, 60 KB)