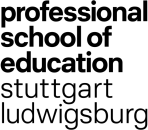Über die Abteilung
Körperbehinderte Kinder sind aufgrund ihrer Bewegungseinschränkung auf Hilfsmittel angewiesen. Je nach Behinderungsart und Ausprägungsgrad werden Hilfsmittel zur Unterstützung des Liegens, des Sitzens, des Stehens und Gehens, zur Grundversorgung, zur Kommunikation sowie in vielen Alltags- und Spielsituationen eingesetzt.
Auf dem Hilfsmittelmarkt existiert ein sehr großes Angebot industriell gefertigter Hilfsmittel, deren Qualität sich in den letzten Jahren zwar ständig verbessert hat, die aber einerseits sehr teuer sind und die andererseits mehr oder weniger für einen anonymen Markt produziert werden. Dies führt dazu, dass Hilfsmittel an Kindergärten oder Schulen oft nicht erworben werden, weil sie nicht finanzierbar sind oder weil sie nicht den Vorstellungen der Betroffenen bzw. der beteiligten Fachkräfte entsprechen oder aber weil es sie im Handel gar nicht gibt.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass vor allem Eltern, Sonderpädagogen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Krankenschwestern, Krankengymnasten usw. eine Fülle von Ideen entwickeln. Diese wurden in der Vergangenheit immer wieder an uns herangetragen und so widmen sich seit einigen Jahren Studierende der Fakultät für Sonderpädagogik im Rahmen eines Seminars der anspruchsvollen Aufgabe, spezifische Hilfsmittel zu konstruieren und herzustellen. Es handelt sich dabei um Arbeiten, die sich an den Bedürfnissen einzelner Kinder und Jugendlicher, an den Wünschen der Fachkräfte an Körperbehindertenkindergärten/Körperbehindertenschulen oder an Ideen von Lehrenden an der Hochschule orientieren. Vor der Realisierung der Hilfsmittel bedarf es etlicher Gespräche mit den Fachkräften an den entsprechenden Einrichtungen, der genauen Beobachtung der Kinder/Jugendlichen und der präzisen Analyse der Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder/Jugendlichen (Behinderung, Körpermaße, Fördermöglichkeiten etc.). Der solchermaßen erstellte Anforderungskatalog bildet die Ausgangslage für Konstruktion, Herstellung, Erprobung und Optimierung der Hilfsmittel. Neben konstruktiven, sicherheitstechnischen und ergonomischen Gesichtspunkten bestimmen Fragen zur Materialauswahl, zu Fertigungstechniken, zur Funktionalität und Kindorientierung die Seminarinhalte. Denn mitentscheidend ist die Akzeptanz des Hilfsmittels seitens des einzelnen Kindes oder der ganzen Gruppe bzw. Klasse. Macht ein Kind positive Erfahrungen, d.h. verbessert oder erleichtert es seine Selbständigkeit, erweitert es seinen Aktionsradius. Bereitet ihm das Hilfsmittel Freude oder führt es zu Erfolgserlebnissen, wird es sich mit dem Hilfsmittel intensiver auseinandersetzen und davon profitieren.
Doch nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Studierenden profitieren von diesen Kooperationen, da sie sich intensiv mit den diversen körperlichen Beeinträchtigungen auseinandersetzen müssen, um ein adäquates Hilfsmittel etc. zu entwickeln und herzustellen. Ein Feedback über die Qualtität der geleisteten Arbeit erfolgt zwangsläufig über die Nutzung dieser Hilfsmittel, Fördermaterialien, Spielgeräte usw. durch die Kinder.
Bislang wurden die folgenden Hilfsmittel konzipiert und hergestellt: Fortbewegungsgeräte, Haltegriffe, Holzbausteine, Kaufladen, Kommunikationsbox, Kugelbahnen, Puppenhaus, Rutsche, Schaukelpferd und andere Schaukelgeräte, Schneebahner (für E-Rollstuhl), Sitzhilfen, Spielhaus, Tastwand, Zauberrad, lenkbares Pedalo, Lesehilfe, Spieltisch, Klangwiege, Spielauto, Esshilfe, Spezialrollbrett etc.
- "Lesehilfe" für ein Kindergartenkind mit Muskeldystrophie
- Klangwiege
- Spieltisch für ein Kindergartenkind
- Spielauto für ein Kind mit cerebraler Bewegungsstörung; Stückliste; Fertigungsplan
- Brettspiel für den Zahlenraum bis 4 für die Eingangstufe an Schulen für Körperbehinderte