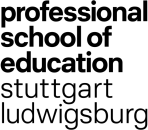Buchempfehlungen
Jeden Monat stellt die STUBE, Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (Wien), ein besonderes Kinder- und Jugendbuch aus der aktuellen Produktion vor.

Weitere Informationen zur STUBE: www.stube.at
Dort sind auch alle Kröten der vergangenen Monate zu finden.
Mit herzlichem Dank an die STUBE-Redaktion, die uns die Inhalte zur Verfügung stellt.
Kröte im Februar 2025
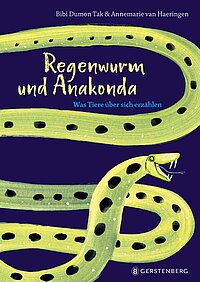
Gerstenberg 2025.
S.128
Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen: Regenwurm und Anakonda. Was Tiere über sich erzählen
Knieschlottern, Frosch im Hals, ein spontaner Schwarm Zitronenfalter im Bauch? Es ist immer aufregend, wenn ein Referat gehalten werden muss – und das womöglich vor der gesamten Klasse! Manche finden während der Vorbereitung in das Thema, fuchsen sich so richtig hinein, treten souverän und mit einem Berg an Wissen an die Tafel und gelten noch Jahre später als Expert*innen auf dem Gebiet. Andere hingegen stottern ihre Notizen vor einer gelangweilten Schar an Zuhörer*innen ab und wünschen sich zwischenzeitlich, es möge ihnen der Trick gelingen, sich effektvoll zu dematerialisieren.
In Bibi Dumon Taks und Annemarie van Haeringens illustriertem Erzählband „Regenwurm und Anakonda“ sind es ausnahmsweise aber nicht Menschen, die ihr gesammeltes Wissen verkünden, sondern die Tiere selbst, die über Tiere Vorträge halten – und das ist alles andere als langweilig. Referate können nämlich superviel Spaß machen. Vor allem, wenn sie mal nicht von der Tierart Mensch gehalten werden. (S. 3)
Zu Wort kommen hier auch nicht nur die Stars der Tierwelt, die sonst prominent die Bühnen der Sach- und Bilderbücher bespielen, wie etwa die üblichen Löwen, Elefanten, Füchse, Bären, Hasen und Mäuschen (nicht, dass sie nicht alle großartig wären!). Nein, hier macht gleich einmal ein ganz Gewöhnlicher den Auftakt, nämlich der Gewöhnliche Putzerfisch, und – zugegeben – er spricht über Haie, aber halt! Das ergibt sich aus der Natur der Sache! Wie wir lernen können, sind Haie die Lieblingskundschaft in seiner Fischwaschstraße, denn beim Haischrubben fällt so einiges für den Gewöhnlichen Putzerfisch ab, nach dem er ganz verrückt ist – Essensreste zwischen scharfen Haibeißerchen und Wundflüssigkeit etwa. Igitt!? Nichts zu ekeln für den Gewöhnlichen Putzerfisch! Und genau hier liegt einer der Punkte, die den besonderen Charme des Buches ausmachen: Es wird aus der Sicht der jeweiligen Tierarten ganz unverblümt nicht nur über animalische Kolleg*innen gesprochen, sondern es wird immer auch aus dem eigenen Leben erzählt. So werden – im übertragenen Sinne – zwei Fliegen mit nur einer Klappe geschlagen (keine Angst, hier kommt keine Fliege zu Schaden, auch keine Fruchtfliege, kein Totenkopfschwärmer oder Lilienhänchen, die allesamt selbst zu Wort kommen): Verpackt in die Referate der Tiere steckt viel und erstaunliches Insiderwissen über die Sprecher*innen selbst. Kein Wunder, sind sie doch Expert*innen auf ihrem eigenen Gebiet.
So erfahren wir, dass der Chor der Geburtshelferkröten wie das Glockenläuten einer Kuhherde in den Bergen (S.18) klingt, die Amsel mitunter neidisch ist auf den immerlauten und chaotischen Halsbandsittich, dem zum Wohlklang der Singvögel das Syrinx (ein Lautbildungsorgan) fehlt oder dass das Breitmaulnashorn in dieselbe Ordnung fällt wie Pferde, Zebras und Wildesel (nämlich Unpaarhufer), mit denen aber gar nicht verwandt ist (im Gegensatz zu den Arten, die in der selben Familie zu finden sind).
Aber auch im Tierreich ist es ein wenig wie in der Menschenklasse: Nicht alle tun sich leicht damit, vor den Zuhörer*innen zu reden. Während etwa der Einsiedlerkrebs vor lauter Aufregung glatt vergisst, über wen er ein Referat halten wollte (es wird hier auch nicht verraten), der Helmkasuar geschlagene 30 Familien der Kolibris aufzählt (so erfahren wir, dass es den Zimtkolibri ebenso wie die Feuerkehlelfe gibt), der Fuchs bei seinem Referat über die Gans nur deren kulinarische Qualitäten lobt oder der Brüllaffe unter allen Möglichkeiten ausgerechnet über das Einhorn fantasiert, parliert der Schneeleopard samt und sonders über sein Lieblingstier: den Schneeleoparden.
Begleitet werden die einzelnen Kapitel von den ansprechenden Illustrationen Annemarie van Haerings, die sowohl die Sprecher*innen als auch die Tiere des jeweiligen Referats teils großflächig, teils filigran-dynamisch in Szene setzt. Letztere, skizzenhafte Illustrationen ziehen sich bis in den Register, der von Geburtshelferkröte und Regenwurm zusammengestellt und kommentiert wird.
„Regenwurm und Anakonda. Was Tiere über sich erzählen“ ist aber mehr als eine Aneinanderreihung von Sachbuchwissen in originellem Gewand. Geschickt wirft es zwischendurch moralische Fragen auf, etwa wenn der Fuchs vor der Gans und den anderen Zuhörer*innen vom Wohlgeschmack der Gänsejungen schwärmt oder das sogenannte Gila-Monster aufgrund seines Namens hinausgeekelt wird. Gleichzeitig legt es aber auch die vielfältigen und teils erstaunlichen Eigenheiten offen, die jedes Tier mit sich bringt und die sich dann doch in den unterschiedlichsten Gemeinsamkeiten wiederfinden (ja, der Koala hat tatsächlich einiges mit der Geburtshelferkröte gemein!). So schufen Bibi Dumon Tak und Annemarie van Haeringen ein gleichermaßen lehrhaftes wie unterhaltsames Gesamtkunstwerk, von dem man sich beim Lesen wünscht, dass die Reihe an Referaten noch lange weitergeführt wird und wir schlussendlich dem Wurm nur zustimmen können:
„Kann ich noch was sagen?“
„Nur zu, Wurm.“
„Sollen wir nächstes Jahr nicht auch Tiere aufnehmen, die mit C,V,X und Y anfangen?“
„Gute Idee, Wurm.“
„Ja, megagute Idee!“ (S. 120)
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Iris Gassenbauer